Der Meerrettich

Armoracia rusticana
Schon bei den alten Griechen und Ägyptern ist er als Heilpflanze, Gewürz und Gemüse bekannt.
Bei uns gelangte er spätestens im Mittelalter, ungefähr ab dem 14. Jahrhundert,
durch die Klöster in unsere Küche und Hausapotheke.
In Österreich und im süddeutschen Raum kennt man ihn auch als "Kren".
Ausdauernd und mit tiefer Pfahlwurzel, lässt er sich hier und da auf Wiesen und Äckern erblicken, wo wir ihn nur an seinen fast senkrecht hohen Blättern erkennen können.
Unser Hauptaugenmerk gilt allerdings der Wurzel, die als biologisches Antibiotikum gilt und unbändige Kraft im Kampf gegen allerlei Leiden vorweisen kann.
Charakteristisch ist sein beißender, scharfer Geruch und Geschmack.
"Radieschen ist mit Blei aufzuwiegen, Rettich mit Silber,
doch der Meerrettich ist sein Gewicht in Gold wert".
Orakel von Delphi
Beschreibung
Er zählt zu der Familie der Kreuzblütler - Brassicaceae. Seine großen länglich gekerbten fast senkrecht stehenden Blätter können bis zu 1,2 m hoch werden, im Frühsommer und Sommer trägt er in seiner Mitte weiße Blüten in Rispen. Die Blätter können zwar auch verwendet werden, jedoch ist die ausdauernde mehrköpfige Pfahlwurzel, der eigentliche Schatz der Pflanze. Diese ist rübenförmig, bis zu 60cm lang, hat einen Ø von 4 bis 5 cm und ist außen gelblich und innen weiß. Dank seines beißenden, scharfen Geruchs und Geschmacks sorgt der Meerrettich dafür, dass man ihn einmal probiert, nicht vergisst.
Vorkommen
Der Meerrettich stammt ursprünglich aus Süd- und Osteuropa. Mittlerweile wird er in Großkulturen im Südosten Deutschlands, Österreich und den USA angebaut.
Ansonsten findet man ihn als „Kulturflüchtling“ auch auf unseren Wiesen und Wegrändern.
In Marburg findet man ihn meist in der Nähe von Äckern, besonders in der großen Felderlandschaft zwischen Michelbach und Görzhausen. Oder auf der Weinstraße bei Wehrda. Allerdings ist es nicht so einfach ihn dort zu sammeln, da er zum besten Erntezeitpunkt eigentlich keine Blätter mehr trägt. Auch die Wurzelgröße ist so nicht abschätzbar.
Kultivierung
Er bevorzugt einen feuchten, nährstoffreichen und lockeren Boden, in der Sonne oder im Halbschatten. Hat er sich einmal angesiedelt, wuchert er stark. Die Vermehrung erfolgt durch die Wurzeln, was zwar recht arbeitsintensiv ist, sich aber lohnt, wenn man ihn ganz praktisch im eigenen Garten ernten möchte.
Im Frühjahr werden die Wurzeln gesetzt, im Sommer aber nochmal ausgraben, um die Seitentriebe - Fechser - zu entfernen, damit die Pflanze sich auf die Hauptwurzel konzentrieren kann. Im 2. oder 3. Jahr ist sie dann erntebereit. Seit langer Zeit ist der Meerrettich ein wichtiger Bestandteil von Bauerngärten, und durch seinen beißenden Geruch vertreibt er z.B. den Kartoffelkäfer.
Theorien der Namensherkunft
Die Entstehung des Namens "Meerrettich" ist uns bis heute ein Rätsel,
denn es gibt dreierlei plausible Erklärungen.
Die erste Theorie besagt, dass er tatsächlich mit dem Meer in Verbindung gebracht werden kann.
Der lateinisch-keltische Name armoracia bedeutet übersetzt "nahe am Meer wachsend".
Damals wurde die Wurzel nämlich gerne vorbeugend gegen Skorbut in der Schiffsküche eingesetzt, der sonst die Seeleute aufgrund Vitamin C-Mangels heimsuchte.
Auch sinnvoll erscheint die simple Erklärung,, dass er schärfer, stärker und gesünder ist als der normale Rettich. Also einfach "mehr" Rettich. Wo über die Jahre dann das "h" hingekommen ist,
bleibt ungeklärt.
Die dritte Vermutung steht im Zusammenhang mit Pferden, zum einen aufgrund des althochdeutschen Wortes "Mähre" und der englischen Bezeichnung "horseradish". Dies und das häufig gemeinsame Auftreten von Meerrettichwurzel und Pferden in unseren Sagen, lässt auch diese Theorie verständlich erscheinen.
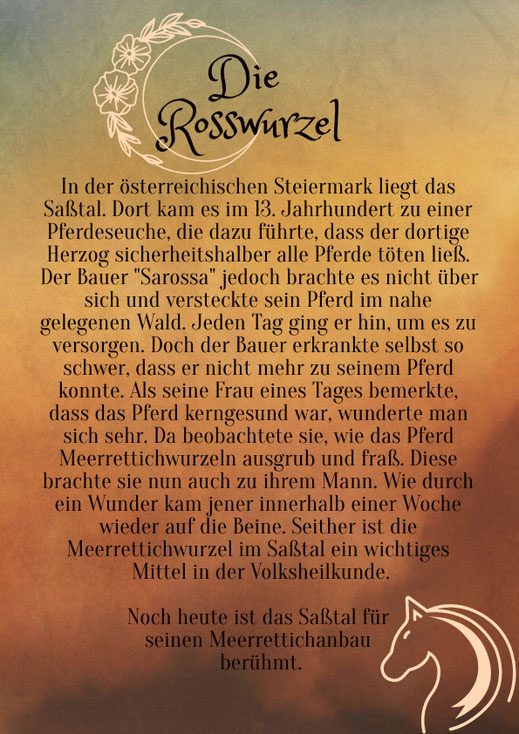
Sammeln & Verarbeiten
Ab September bis noch in den Februar hinein können die Wurzeln ausgegraben werden. Der ideale Zeitpunkt ist, wenn die Pflanze ihre Blätter eingezogen hat. Dafür sollte man natürlich den Standort kennen. Dann wird er entweder frisch verwendet, oder im Keller dunkel und frostsicher in Erde oder Sand eingelagert.
Die Wurzel muss gründlich gewaschen werden. Beim Schälen ein gutes Messer benutzen und immer nur den Teil, der verwendet wird schälen. Die gängigste Verarbeitungsmethode ist, ihn fein zu reiben.
Man kann ihn auch nach der Verarbeitung zu Sahnemeerrettich oder Ähnlichem in kleinen Portionen einfrieren. Auch das Einlegen der Wurzelraspel in Essig ist möglich.
Verwendung
Seine starke antibakterielle Wirkung macht ihn zu einem wertvollen Mittel der Naturheilkunde. In Verbindung mit Kapuzinerkresse gilt er sogar als pflanzliches Penizillin. Allein das Reiben, wenn die ätherischen Öle in die Nase steigen, ist schon gesund!
Medizinisch: bei Atemwegsinfekten; bei antibiotikaresistenten Problemkeimen
Volksmedizin: mit Honig bei Husten, Blasenproblemen;
frisch gerieben als Breiumschlag (max. 5-10 min) bei Rücken- und Nackenschmerzen, Rheuma, Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Sommersprossen, Asthma, Insektenstichen;
als Tinktur, als Wein, als Sirup zur Stärkung des Immunsystems;
Hildegard von Bingen setzte ihn bei Hexenschuss ein.
Kulinarisch: Brotaufstrich, Beigabe Fleischgerichte, besonders zu kalten Rind- und Schweinegerichten, zu Räucherfisch, als Meerrettichsauce oder -suppe
Rezepte zum Ausprobieren

Meerrettich-Kapuzinerkresse-Tinktur
Zutaten:
2 Hände voll Kapuzinerkresseblätter- und blüten (ca. 150g)
2 cm frische Meerrettichwurzel - in der Saison in gut sortierten Gemüseläden
mind. 43 % Alkohol - Obstschnaps oder Vodka
1 Schraubglas
1 Tinkturfläschchen mit Tropfenaufsatz
Zubereitung:
Die Blätter und Blüten der Kapuzinerkresse vorsichtig abbrausen. Dann klein schneiden und in ein Schraubglas füllen.
Die Meerrettichwurzel gründlich abschrubben und ungeschält fein reiben. Auch in das Glas geben.
Jetzt mit dem Alkohol aufgießen, sodass alle Teile bedeckt sind.
Das Glas fest zuschrauben und für 4 Wochen auf das Fensterbrett stellen, aber nicht in direktes Sonnenlicht. Dabei immer wieder leicht schwenken.
Nach den 4 Wochen die Tinktur filtern und in ein Fläschchen mit Tropfenaufsatz füllen.
Die Flasche sollte entweder aus Braunglas sein oder dunkel gelagert werden.
Zeitaufwand: 2o min + 4 Wochen Wartezeit
Anwendung: Täglich 10 Tropfen als Infektionsschutz und bei den ersten Anzeichen einer Erkältung einnehmen.
Die Kombination aus Kapuzinerkresse und Meerrettich kann mit der Wirkung eines Antibiotikums gleichgesetzt werden.
Zur Info: Kapuzinerkresse enthält unter anderem auch Senföle
und Vitamin C.

Meerrettich-Rote Bete-Aufstrich
Zutaten:
250 g gekochte Rote Bete oder 2 Knollen
60 g Cashewkerne
2 EL neutrales, qualitatives Pflanzenöl - z.B. Sonnenblumenöl
2 EL frisch gepresster Zitronensaft
2 EL Apfelessig
4 TL frisch geriebener Meerrettich
Salz und Pfeffer
1 Schraubglas
Zubereitung:
Die gesamten Zutaten im Mixer pürieren, auch ein Stabmixer ist geeignet. Die richtige Konsistenz ist erreicht, wenn sich alles gut miteinander verbunden hat.
Jetzt nur noch mit Salz und Pfeffer abschmecken.
Im Kühlschrank hält sich der Aufstrich einige Tage. Für eine bessere Haltbarkeit kann man die Oberfläche mit Pflanzenöl bedecken. Größere Mengen des Aufstrichs werden am besten portionsweise in kleine Gläser gefüllt und eingefroren.
Zeitaufwand: 15 min
Eine Verbindung von Rote Bete und Meerrettich ist ein natürlicher Booster für unser Immunsystem, Rote Bete kann nämlich auch mit einem hohen Gehalt an Vitamin C punkten.
Hinweis: Der Besuch dieser Seite ersetzt nicht die Beratung eines Arztes oder Apothekers.
Buchquellen:
"Kräuterwissen aus alter Zeit", Burkhard Bohne, Stuttgart, 2021
"Das große Buch der Heilpflanzen", Pahlow, München, 1993
"Wickel, Salben & Tinkturen", Arnold Achmüller, Bozen, 2016
" Kräuterbibel - Kräuterporträts, Kochrezepte, Pflanztipps und Heilkunde", Jennie Harding, Köln, 2017
